Giordano Bruno!
Ihn ließ die römische Inquisition im Jahre 1600 auf dem Scheiterhaufen verbrennen – wegen Ketzerei. Er war klein von Wuchs, aber groß an Mut. Keine Angst hatte er vor den Inquisitoren. Von seiner moralischen Größe spricht auch die folgende Geschichte.
Ein reicher Patrizier in Venezia lud den Gelehrten in sein Haus ein. Giordano Bruno sollte ihn in Physik und Logik unterrichten. Für den Unterricht zählte der Patrizier ihm mit Wohnung und Essen. Dabei hatte der Patrizier gehofft, dass Giordano ihn die schwarze Magie lehren wird.,Ein so berühmter Mann muss das doch können', dachte er. Als es nicht geschah, denunzierte der Patrizier den Gelehrten. „Er ist ein Antichrist", schrieb er an die Inquisition, „denn er sagt, es gibt nicht nur eine, sondern zahllose Sonnen."
Die Polizei der Inquisition holte den Gelehrten in der Nacht auf den 25. Mai 1592 ab und warf ihn ins Gefängnis. Dort blieb er bis zum 17. Februar 1600, als er den Scheiterhaufen besteigen musste. Während der acht Jahre, die der schreckliche Prozess dauerte, kämpfte er mutig um sein Leben.
In diese Zeit fällt die Geschichte mit seinem Mantel.
Im Winter 1592 hatte er sich bei einem Schneider einen Mantel nähen lassen. Als er verhaftet wurde, war der Mantel noch nicht bezahlt. Auf die Nachricht von der Verhaftung des Gelehrten lief der Schneider in das Haus des Patriziers und forderte sein Geld. Aber Giordano war schon im Gefängnis. Man sagte ihm: „Laufen Sie ins Tribunal der Inquisition, wenn Sie ein Bekannter des Ketzers sind."
Der Schneider stand erschrocken auf der Straße. Als sich auch noch Menschen um ihn versammelten, lief er voller Angst um die Ecke und in sein Haus. Es war gefährlich, mit diesem Ketzer bekannt zu sein, — das hatte er verstanden. Seiner Frau erzählte er nichts von seinem Unglück, und sie wunderte sich eine Woche lang über die Unruhe ihres Mannes.
Aber am 1. Juni erfuhr sie aus den Geschäftsbüchern ihres Mannes, dass ein Mantel nicht bezahlt war. Es war der Mantel für Giordano Bruno. Und der Ketzer war Stadtgespräch.
Die Frau des Schneiders wollte aber ihr Geld nicht verlieren. Und so ging die Siebzigjährige in ihren Sonntagskleidern in das Gebäude der Inquisition und verlangte mit bösem Gesicht die zweiunddreißig Skudi, die ihr der verhaftete Ketzer schuldig war. Der Beamte, mit dem sie sprach, schrieb ihre Forderung auf und versprach, die Sache zu klären.
Der Schneider wurde auch wirklich bald gerufen. Zitternd vor Angst ging er in das gefürchtete Gebäude. Man sagte ihm, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen war, vielleicht wird man ihm später die Schulden des Ketzers auszahlen.
Der Schneider war froh, dass er so billig davongekommen war. Seine Frau aber war damit nicht zufrieden. In der Küche und auf dem Hof schrie sie: „Warum verhaftet man denn einen Ketzer, bevor er seine Schulden bezahlt hat! Meine zweiunddreißig Skudi will ich haben, und wenn ich darum bis zum Papst in Rom gehen muss!"
Bald sprach man in der Stadt immer mehr darüber, dass die Sache des Ketzers schlecht stand. Er wird nie mehr frei werden, meinte man. „Dann bekomm ich also auch mein Geld nicht mehr!“ schrie die alte Frau weiter im Hof und auf der Straße. „Die Inquisition handelt falsch!“
Eines Tages holte ein Beamter die Alte zur Inquisition. Man gab ihr zu verstehen, dass sie schweigen sollte, und dass man genügend Mittel besitzt, sie das Schweigen zu lehren.
Eine Zeitlang half das. Sie hielt sich still. Aber im September begann man sich in der Stadt zu erzahlen: „Der Ketzer muss bald zum Großinquisitor nach Rom.“
Die alte Frau war außer sich vor Empörung. Wollte man den Ketzer denn wirklich nach Rom bringen, ohne dass er seine Schulden bezahlt hatte! Kaum hatte sie diese unglaubliche Nachricht erfahren, als sie auch schon zur Inquisition lief.
Sie wurde diesmal von einem höhern Beamten empfangen. Der war viel höflicher zu ihr als die vorigen gewesen waren. Er war beinahe so alt wie sie selber und hörte sich 
 ihre Klage ruhig und aufmerksam an. Als sie fertig war, fragte er sie nach einer kleinen Pause:
ihre Klage ruhig und aufmerksam an. Als sie fertig war, fragte er sie nach einer kleinen Pause:
„Wollen Sie den Bruno sprechen?“
Sie bejahte die Frage.
Am nächsten Vormittag trat ihr in einem engen Gefängniszimmer ein kleiner magerer Mann entgegen und fragte sie höflich nach ihrem Wunsch. Sie hatte ihn früher einige Male gesehen, als er den Mantel anprobierte. Sie erkannte ihn aber nicht sofort. Er hatte sich im Gefängnis stark verändert.
Sie sagte aufgeregt: „Der Mantel. Sie haben ihn nicht bezahlt.“
Er sah sie einige Sekunden verwundert an. Dann erinnerte er sich und sagte mit leiser Stimme: „Was bin ich Ihnen schuldig?“
„Zweiunddreißig Skudi", sagte sie, „Sie haben es sich doch notiert.“
Er drehte sich zu dem großen, dicken Beamten um und fragte ihn: „Wissen Sie nicht, wie viel Geld zusammen mit meinen Sachen in der Inquisition abgegeben wurde?“ Der Beamte wusste es nicht, versprach aber, es festzustellen.
„Wie geht es Ihrem Mann?“ fragte der Gefangene. Die Alte war von der Freundlichkeit des Mannes verwirrt und antwortete leise: „Es geht ihm gut.“
Sie ging erst zwei Tage später wieder zur Inquisition.,Jetzt hat der Beamte das mit dem Geld hoffentlich schon geklärt', dachte sie.
Sie erhielt wirklich die Erlaubnis, den Gefangenen noch einmal zu sprechen. Er sah sehr müde aus, als er eine Stunde später in das kleine Gefängniszimmer geführt wurde. Man hatte ihn sehr streng verhört. Doch sprach er sofort zur Sache, mit schwacher Stimme.
„Ich kann den Mantel leider nicht bezahlen. Man hat bei meinen Sachen kein Geld vorgefunden. Verlieren Sie aber die Hoffnung nicht. Ich habe nachgedacht und erinnere mich, dass bei einem Mann noch Geld für mich liegen muss. Dieser Mann lebt in der Stadt Frankfurt. Er hat Bücher von mir gedruckt. Wenn man es mir erlaubt, schreibe ich an ihn. Ich werde morgen um die Erlaubnis bitten.“
Die Alte sah ihn mit scharfen Augen an, während er sprach. Sie kannte die Ausreden schlechter Zahler, die immer nur Schulden machten.
„Wozu brauchten Sie einen Mantel, wenn Sie kein Geld hatten, ihn zu bezahlen?“ fragte sie hart.
Der Gefangene nickte, um ihr zu zeigen, dass er sie verstand. Er antwortete:
„Ich habe immer verdient, mit Buchern und mit Lehren. Und ich glaubte ja damals, dass ich den Mantel brauche. Ich meinte, dass ich frei herumgehen werde.“ Das sagte er ganz ruhig.
Die Alte sah ihn noch einmal von oben bis unten an. Dann lief sie aus dem Zimmer, ohne ein Wort zu sagen.
„Wer wird denn einem Mann, der vor der Inquisition steht, noch Geld schicken!“ sagte sie später böse zu ihrem Mann.
„Der hat wohl jetzt an anderes zu denken“, antwortete der alte Schneider.
Sie sagte nichts mehr.
Die nächsten Monate vergingen, ohne dass etwas Neues geschah. Und dann wurde sie auf Brunos Bitte in die Inquisition gerufen.
Und die alte Frau ging an einem Nachmittag hin.
Sie wurde wieder von dem ihr schon bekannten höflichen alten Beamten empfangen. Bald führte man den Gefangenen in das kleine Zimmer herein.
„Es ist kein Geld für mich gekommen“, sagte er, „ich habe zweimal darum geschrieben, aber es ist nicht gekommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht nehmen Sie einfach den Mantel zurück.“
„Ich wusste ja, dass es so kommen wird“, sagte sie verächtlich. „Und er ist nach Maß gearbeitet und zu klein fürdie meisten.“
Der Gefangene sah gequält auf die alte Frau.
„Daran habe ich nicht gedacht“, sagte er und wandte sich an den Beamten, der ihn geholt hatte, den großen Dicken:
„Kann man nicht alle meine Sachen verkaufen und das Geld diesen Leuten geben?“
„Das wird nicht möglich sein“, antwortete dieser. „Das Geld will der Patrizier haben, bei dem Sie wohnten. Sie haben lange auf seine Kosten gelebt.“
„Er hat mich eingeladen“, antwortete der Gefangene müde.
Der höhere Beamte hob jetzt seine Hand.
„Darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich denke, dass der Mantel zurückgegeben werden soll.“
„Was sollen wir mit ihm machen?“ sagte die Alte böse.
Der Beamte wurde ein wenig rot im Gesicht. Er sagte langsam:
„Liebe Frau, der Angeklagte steht vor einem Verhör, das für ihn Leben oder Tod bedeuten kann. Sie können doch nicht fordern, dass er sich jetzt auch noch für Ihren Mantel interessiert.“
Die Alte sah ihn an. Sie erinnerte sich plötzlich, wo sie stand. Sie wollte schon gehen, da hörte sie den Gefangenen mit leiser Stimme sagen:
„Ich meine, dass Sie es fordern kann.“
Und als sie sich zu ihm umdrehte, sagte er noch:
„Sie müssen das alles entschuldigen. Denken Sie auf keinen Fall, dass mich Ihr Verlust nicht interessiert.“
Auf ein Zeichen des höheren Beamten war der große Dicke vorher aus dem Zimmer gegangen. Jetzt kam er zurück und sagte:
„Der Mantel ist überhaupt nicht abgegeben worden. Wahrscheinlich hat ihn der Patrizier genommen."
Der Gefangene erschrak. Dann sagte er fest:
„Darauf hatte er kein Recht. Ich werde ihn verklagen“
Der Beamte schüttelte den Kopf.
„Denken Sie lieber an das Verhör, das in ein paar Minuten kommt. Ich kann es nicht länger erlauben, dass hier um ein paar Skudi so viel gesprochen wird.“
Der Alten stieg das Blut in den Kopf. Während der Gefangene sprach, hatte sie geschwiegen und in eine Ecke des Zimmers geschaut. Aber jetzt riss ihr wieder die Geduld.
„Ein paar Skudi!“ schrie sie. „Das ist ein Monatsverdienst! Sie haben gut reden. Sie verlieren nichts dabei!“
In diesem Moment trat ein dritter Beamter in die Tür.
„Der Prokurator ist gekommen“, sagte er halblaut und sah verwundert auf die schreiende Frau.
Der große Dicke fasste Giordano Bruno am Arm und führte ihn hinaus. Dieser blickte über die Schulter zurück auf die alte Frau. Sein Gesicht war sehr blass.
Die Alte ging verwirrt die Steintreppe hinunter. Sie wusste nicht, was sie denken sollte. Eigentlich tat der Mann, was er konnte.
Als eine Woche später der große Dicke den Mantel brachte, ging sie nicht ins Zimmer. Aber sie stand an der Tür. Und da hörte sie, wie der Beamte sagte: „Er hat wirklich noch die ganzen letzten Tage sich um den Mantel gekümmert. Zwischen den Verhören machte er zweimal eine Angabe. Der Patrizier musste den Mantel herausgeben. Übrigens wird er noch diese Woche nach Rom marschieren müssen, zum Großinquisitor. Und da konnte er den Mantel jetzt gut brauchen."
Das stimmte. Es war Ende Januar.
Erläuterungen:
denunzieren—доносить на кого-л.
Und der Ketzer war Stadtgespräch. — А об этом еретике говорил весь город.
Skudi — скуди (итальянская монета)
der Papst in Rom — папа Римский
vor Empörung außer sich sein — быть вне себя от возмущения
verwirrt sein — зд.: быть смущенным
verhören — допрашивать
verächtlich — презрительно
nach Maß arbeiten — шить по мерке
gequält — с измученным видом
auf j-s Kosten leben — жить на чей-л. счет
der Angeklagte — обвиняемый
der Verlust — зд.: убыток, потеря
j-n verklagen — подать жалобу в суд на кого-л.
den Kopf schütteln — покачать (головой)
ihr riss die Geduld — у нее лопнуло терпение
Eingabe machen - подавать заявление
3. Lesen Sie den Text durch und erzahlen Sie ihn kurz nach
Leben des Galilei
Folter und Scheiterhaufen — пытка и смерть на костре
schwören — дать клятву
Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik zu Padua, will das neue kopernikanische Weltsystem beweisen.
In dem Jahre sechzehnhundertundneun
Schien das Licht des Wissens hell
Zu Padua in einem kleinen Haus.
Galileo Galilei rechnete aus:
Die Sonne steht still, die Erd' kommt von der Stell'.
Das ärmliche Studierzimmer des Galilei in Padua. Es ist Morgen. Ein Junge, Andrea, der Sohn der Haushalterin, bringt ein Glas Milch und ein Brötchen.
Galilei (sich den Oberkörper waschend, fröhtich): Stell die Milch auf den Tisch, aber schlag kein Buch zu.
Andrea: Mutter sagte, wir müssen den Milchmann bezahlen. Sonst macht er bald einen Kreis um unser Haus, Herr Galilei.
Galilei: Hast du, was ich dir gestern sagte, endlich begriffen?
Andrea: Was? Das mit dem Kopernikus und seinem Drehen?
Galilei: Ja.
Andrea: Nein. Warum wollen Sie denn, dass ich es begreife? Es ist sehr schwer, und ich bin im Oktober erst elf.
Galilei: Ich will gerade, dass auch du es begreifst. Dazu, dass man es begreift, arbeite ich und kaufe die teuren Bücher, statt den Milchmann zu bezahlen.
Andrea: Aber ich sehe doch, dass die Sonne abends woanders halt als morgens. Da kann sie doch nicht still stehen! Nie und nimmer!
Galilei: Du siehst! Was siehst du? Du siehst gar nichts. Du glotzt nur. Glotzen ist nicht sehen. (Er stellt den eisernen Waschtisch in die Mitte des Zimmers.) Also das ist die Sonne. Setz dich. (Andrea setzt sich auf einen Stuhl. Galilei steht hinter ihm.) Wo ist die Sonne, rechts oder links?
Andrea: Links.
С a 1 i 1 e i: Und wie kommt sie nach rechts?
Andrea: Wenn Sie sie nach rechts tragen natürlich.
Galilei: Nur so? (Er hebt ihn zusammen mit dem Stuhl auf und macht mit ihm eine halbe Drehung.) Wo ist jetzt die Sonne?
Andrea: Rechts.
Galilei: Und hat sie sich bewegt?
Andrea: Das nicht.
Galilei. Was hat sich bewegt?
Andrea: Ich.
Galilei (schreit): Falsch! Dummkopf! Der Stuhl!
Andrea: Aber ich mit ihm!
Galilei: Natürlich. Der Stuhl ist die Erde. Du sitzt drauf. (Frau Sarti ist eingetreten und hat zugeschaut.)
Frau Sarti: Was machen Sie eigentlich mit meinem Jungen, Herr Galilei?
Galilei: Ich lehre ihn sehen, Sarti.
Frau Sarti: Dazu tragen Sie ihn im Zimmer herum?
Andrea: Lass doch, Mutter. Das verstehst du nicht.
Frau Sarti: So? Aber du verstehst -es, wie? Ein junger Herr, der Unterricht wünscht. Sehr gut angezogen und bringt einen Empfehlungsbrief3. (Sie übergibt den Brief.) Sie bringen meinen Andrea noch so weit, dass er sagt, zwei mal zwei ist fünf. Er verwechselt schon alles, was Sie ihm sagen. Gestern abend bewies er mir schon, da8 die Erde sich um die Sonne dreht. Er ist fest überzeugt, dass ein Mann namens Kopernikus das ausgerechnet hat.
Andrea: Hat es der Kopernikus nicht ausgerechnet, Herr Galilei? Sagen Sie es ihr selber!
Frau Sarti: Was, Sie sagen ihm wirklich solche Dummheiten? Dass er es in der Schule weitererzahlt 


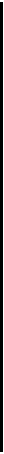 und die Herren von der Inquisition zu mir kommen, weil er das unheilige Zeug nachredet. Sie sollen sich schämen, Herr Galilei.
und die Herren von der Inquisition zu mir kommen, weil er das unheilige Zeug nachredet. Sie sollen sich schämen, Herr Galilei.
Galilei (frühstückend): Auf Grund unserer Forschungen, Frau Sarti, haben nach heißem Disput Andrea und ich Entdeckungen gemacht, die wir nicht langer der Weit gegenüber geheim halten können. Eine Neue Zeit beginnt, eine große Epoche, in der zu leben eine Lust ist.
Frau Sarti: So. Hoffentlich können wir auch den Milchmann bezahlen in dieser neuen Zeit, Herr Galilei. (Auf den Empfehlungsbrief zeigend.) Tun Sie mir den einzigen Gefallen und schicken Sie den jungen Mann nicht auch wieder weg. Ich denke an die Milchrechnung.
Erläuterungen
 von der Stelle kommen — двигаться
von der Stelle kommen — двигаться
die Haushälterin — экономка
einen Kreis machen um etw. — обходить что-л. кругом
begreifen -- verstehen
Nie und nimmer! — Никогда!
glotzen—таращить глаза
der Empfehlungsbrief — рекомендательное письмо
j-n so weit bringen - зд.: довести кого-л. до
verwechseln — путать
WOLFGANG BORCHERT
(1921-1947)
Das Leben des Dichters dauerte nur knappe sechsundzwanzig Jahre. Borchert hat nicht viel geschrieben. Fast alles, was er geschaffen hat, entstand in den beiden ersten Naсhkriegsjahren.
W. Borchert wurde in Hamburg im Jahre 1921 in einer bürgerlichen Familie geboren. Die Eltern ließen ihren Sohn den Beruf eines Buchhändlers erlernen, er wollte aber Schauspieler werden.
Als der zweite Weltkrieg ausbrach, war er achtzehn Jahre alt, er wurde einberufen, und der Krieg zerstörte alle seine Pläne.
Borchert missachtete die faschistische Propaganda, die er überall hören musste, keinem Wort schenkte er Glauben.
Als Soldat blieb er seiner antifaschistischen Gesinnung treu und verspottete alle Reden über die Unfehlbarkeit des Führers, über die Überlegenheit der arischen Rasse, über die historische Mission der Germanen, und das bedeutete für ihn wiederholte Verhaftungen.
Der Krieg brachte Borchert ungeheure Prüfungen und Leiden, er musste auch die Leiden anderer Menschen aus der nächsten Nähe beobachten.
1942 war Borchert schwer verwundet. Im Lazarett wurde er wegen aufrechter antifaschistischer Gesinnung verhaftet. Neun Monate dauerte die Haft, schließlich wurde er zum Tode verurteilt.
Aus unbekannten Gründen hob das Kriegsgericht die Todesstrafe auf, und statt auf der Stelle hingerichtet zu werden, wurde Borchert in ein Strafbataillon an die Ostfront geschickt, wo er bald verwundet wurde. 1944 kerkerte die Gestapo Borchert zum zweitenmal ein. Die Anklage gegen ihn lautete: „Zersetzung der Wehrmacht", und er musste wieder an die Front. Die Gefangennahme durch die Amerikaner beendete diese qualvolle Zeit.
Erst 1945 kehrte Borchert nach Hause in seine Heimatstadt zurück. Aber in welchem Zustand — körperlich ruiniert, seelisch tief erschüttert. Sein Leben in Hamburg während der ersten Nachkriegsjahre war hart. Jetzt hatte er die Gelegenheit, seine Begabung für die theatralische Kunst zu erproben. Er arbeitete als Kabarettist, dann als Regieassistent am Hamburger Schauspielhaus. Der todkranke Dichter hungerte, das Fieber verzehrte seinen Körper. In der Dichtung suchte er Befreiung von den quälenden Erinnerungen an die Kriegserlebnisse, und es entstanden in rascher Folge Gedichte und Erzählungen.
Während zweier Jahre entwickelte sich Borchert zu, einem bedeutenden Dichter. Er schrieb leidenschaftlich, beinahe hastig, er wusste schon, dass ihm nur noch wenig Zeit blieb. Das Problem der Verantwortung quälte Borchert, er konnte keine Antwort finden, er wusste aber, dass diese Frage eine Antwort verlangte. Borcherts Gedichte sind sehr musikalisch, manchmal ist ihre Form erlesen, manchmal ganz schlicht. Sie sind immer traurig, wie auch das gesamte Werk von Borchert traurig ist. (Die erste Gedichtsammlung heißt „Laterne, Nacht und Sterne", 1946.)
Eine besondere Erscheinung in der deutschen Nachkriegsliteratur bilden die Erzählungen von Borchert.
Das Hauptthema ist der Krieg, der Hass gegen den Krieg beherrscht jede Erzählung, jede von Borchert geschriebene Zeile.
Er fand immer neue Situationen, immer neue packende Wendungen, um seinem leidenschaftlichen Appell an alle Menschen, den Frieden zu bewahren, Ausdruck zu verleihen. Trotz seiner schweren Krankheit arbeitete er unermüdlich; er gönnte sich keine Ruhe. Den Höhepunkt seiner Meisterschaft erreicht Borchert in dem einzigen Drama, das er hinterlassen hat: „Draußen vor der Tür". Er schrieb es in 8 Tagen und errang damit Weltruf.
Der Held des Dramas, der ehemalige Unteroffizier Beckmann, kommt nach Hause. Er kann aber weder Obdach noch Arbeit in seiner Heimat finden. Niemand braucht ihn, in seiner Einsamkeit ist er tief unglücklich.
Die Kriegserinnerungen verfolgen Beckmann, sein Leben ist sinnlos, aber er muss leben, das ist seine Überzeugung.
Das Stück besteht aus mehreren Episoden. Neben dem lyrischen Helden, neben dem körperlich und seelisch entstellten Beckmann, wirken auch andere Personen, die stark satirisch, oft auch grotesk dargestellt sind. Unter diesen zahlreichen Menschen ist niemand, der Beckmann helfen will.
Die Uraufführung im Hamburger Radio konnte der kranke Dichter nicht hören. Er befand sich damals in einem Sanatorium in der Schweiz, Dort starb er an einer unheilbaren Leberkrankheit.
In seinem Werk ist Wolfgang Borchert immer bitter und traurig, aber er verliert nicht den Glauben an den Menschen. Das beweisen seine Erzählungen, fast in jeder von ihnen spürt man diesen festen Glauben an das Gute, Edle, Großzügige, was dem Menschen eigen ist („Die Hundeblume", „Die drei dunklen Könige", „Das Brot", „Jesus macht nicht mehr mit" u. a.).
Die vorliegende Erzählung „Die Kegelbahn" gehört in die Reihe der stärksten Antikriegsdichtungen und bezeugt mit erschütternder Kraft den Hass und die Verzweiflung des ehemaligen Soldaten Wolfgang Borchert Selbst der metaphorische Titel „Die Kegelbahn" hat einen schauerlichen Sinn.
Die handelnden Personen sind nicht genannt, sie werden auch nicht Soldaten genannt, es sind Männer, sie haben ein Gewehr genommen, und sie müssen schießen.
Der Kopf, auf den sie schießen, ist der Kopf eines anderen Menschen, dessen Sprache sie nicht einmal verstehen, der aber atmen und essen und Heben will, die beiden Männer haben ihn getötet, denn;,das hatte einer befohlen".
Unter diesem „einen" kann man den Offizier, den Befehlshaber oder Hitler selbst verstehen.
In der Nacht, wenn die kaputtgemachten Köpfe mit leisem Donner rollen, beginnt das entscheidende Gespräch zwischen den beiden:
„Aber man hat es doch befohlen, flüsterte der eine.
Aber wir haben es getan, schrie der andere.
Aber es war furchtbar, stöhnte der eine.
Aber manchmal hat es auch Spaß gemacht, lachte der andere".
Der Wortwechsel zeigt die Denkart der Partner. Einer von beiden bekommt jetzt Angst, vielleicht auch Reue, der andere findet einen grauenvollen Spaß daran, er kennt keine Skrupel. Die Männer wissen weder weshalb noch wozu sie schießen. Und wenn sie dann wieder einen Kopf sehen, schießen sie beide weiter und vergrößern den Berg der Köpfe. Wer hat die Verantwortung dafür zu tragen? Das ist die zentrale Frage, die Borchert nicht beantworten konnte, die ihn aber ständig peinigte.
1. Lesen Sie den Text durch, stellen Sie eine Aufgliederung des Textes zusammen und erzählen Sie den Text nach.
Das Brot
Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war still und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte: sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht.
Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts. Um halb drei. In der Küche.
Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tisch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hoch kroch. Und sie sah von dem Teller weg.
„Ich dachte, hier wäre was", sagte er und sah in der Küche umher.
„Ich habe auch was gehört", antwortete sie und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiundsechzig. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er, im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt.
„Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuss auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich noch."
Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass er log. Dass er log, nachdem sie neununddreißig Jahre verheiratet waren.
„Ich dachte, hier wäre was", sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere, „ich hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was."
„Ich hab auch was gehört. Aber es war wohl nichts." Sie stellte den Teller vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke.
„Nein, es war wohl nichts", echote er unsicher.
Sie kam ihm zu Hilfe: „Komm man. Das war wohl draußen. Komm man zu Bett. Du erkältest dich noch. Auf den kalten Fliesen."
Er sah zum Fenster hin. „Ja, das muss wohl draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier."
Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muss das Licht jetzt ausmachen, sonst muss ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. „Komm man", sagte sie und machte das Licht aus, „das war wohl draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer."
Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße platschten auf den Fußboden.
„Wind ist ja", meinte er, „Wind war schon die ganze Nacht."
Als sie im Bett lagen, sagte sie: „Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne."
„Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne." Er sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre.
Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. „Es ist kalt", sagte sie und gähnte leise, „Ich krieche unter die Decke. Gute Nacht."
„Nacht", antwortete er und noch: „ja, kalt ist es schon ganz schön-"
Dana war es still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief.
Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können.
„Du kannst ruhig vier essen", sagte sie und ging von der Lampe weg. „Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Iß du man eine mehr. Ich vertrag es nicht so gut."
Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr leid.
„Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen", sagte er auf seinen Teller.
„Doch. Abends vertrag ich das Brot nicht gut. Iss man. Iss man."
Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch.
2. Schreiben Sie 10 Fragen zum Text und gebrauchen Sie diese Fragen zum Nacherzählen dieses Textes.
Die Hundeblume
Die Tür schloss sich hinter mir. Eine Tür mit der Nummer 432. Das ist das Besondere an der Tür, dass sie eine Nummer hat. Ich bin in der Zelle 432.
Als die Sonne ihre Finger von dem Fenstergitter nahm und die Nacht aus den Ecken kroch, trat etwas aus dem Dunkel auf mich zu — und ich dachte: Hat jemand die Tür geöffnet? Bin ich nicht mehr allein? Ich fühlte, es ist etwas da, und das atmet und wächst. Die Zelle wurde zu eng...
Du, Nummer 432, — fürchte dich nicht vor der Nacht. Deine Angst ist mit dir in der Zelle, sonst nichts! Die Angst und die Nacht!...
Da kam der Mond über die Dächer und leuchtete die Wände ab. Du Esel! sagte ich zu mir. Die Wände sind so eng wie schon immer, und die Zelle ist ganz leer. Und was da früher war, das, was sprach, war in dir. — Du warst es! Das ist Alles. Aber das ist so viel, dass es nicht mehr sein kann. Sonst ist nichts. Aber dieses Nichts siegt oft über unser Denken.
Die Zellentür war fest geschlossen, und man wusste, dass sie sich von selbst nicht öffnen konnte.
Ich gewöhnte mich langsam an mich... Nach unendlich langer Zeit wurde die Tür geöffnet, die Tür 432, und noch viele andere. Jede der Türen ließ einen schmutzigen, langhaarigen, blassen Mann austreten, sich in eine lange Reihe stellen und in einen Hof treten mit einem kleinen grünen Grasflecken in der Mitte und hohen grauen Mauern ringsum.
Da hörten wir ein lautes Bellen. Das kam von Hunden in blauen Uniformen. Die hielten uns in Bewegung und waren selbst die ganze Zeit in Bewegung. Bald erkannten wir, dass es Polizisten waren.
Wir liefen im Kreise. Siebzig, achtzig Mann vielleicht. Und immer im Kreis — im Rhythmus unserer Holzschuhe. Und doch waren wir wenigstens für eine halbe Stunde froher als sonst.
So war es zuerst. Fast ein Fest, ein kleines Glück. Aber mit der Zeit genügt so ein kleines Glück nicht mehr — man bekommt es satt. Und dann kommt der Tag, wo der Rundgang im Kreis eine Qual wird. So ist das in unserem Kreis hinter den hohen grauen Mauern mit dem grünen Gras in der Mitte.
Da machte ich eines Tages eine Entdeckung, die mir das Blut in den Kopf steigen ließ. Keine große Sache. Nur eine ganz kleine Entdeckung.
Als wir so den kleinen schmutzigen grünen Fleck in der Mitte des Hofes umkreisten, fiel mein Blick plötzlich auf einen gelben Punkt im Gras. Ich erkannte eine Blume, eine gelbe Blume. Es war ein Löwenzahn — eine kleine gelbe Hundeblume.
Ich war erschrocken über meine Entdeckung: haben. die blauen Hunde gesehen, wohin meine Augen schauten? Dann ist die Blume verloren! Aber niemand hatte etwas bemerkt. Ich schaute auch nicht mehr hin, freute mich aber sehr über die Entdeckung.
Aber richtig freuen konnte ich mich nur wenige Tage an der Blume. Ich wollte sie ganz haben. Immer, wenn unser Rundgang zu Ende ging, konnte ich mich beinahe nicht von ihr losreißen. Und ich war bereit, meine tägliche Brotration dafür herzugeben, um sie mitnehmen zu können in die Zelle Nummer 432. Die Sehnsucht, etwas Lebendiges in der Zelle zu haben, war so stark, dass ich meinte, ich konnte nicht länger ohne die Blume leben. Ich musste sie haben.
Ich fing es sehr listig an. Jedesmal, wenn ich an meiner Blume vorbeikam, trat ich so unbemerkbar wie möglich einen Fußbreit vom Wege auf den Grasfleck. Mein Hintermann, sein Hintermann, dessen Hintermann — und so weiter — taten es mechanisch mir nach und gingen meine Spur. So gelang es mir in vier Tagen, unsern Weg so nahe an meine Hundeblume heranzubringen, dass ich sie mit der Hand fassen konnte, wenn ich mich bückte.
Ich näherte mich der Erfüllung meines Wunsches. Zur Probe ließ ich einige Male meinen linken Strumpf runterrutschen, bückte mich scheinbar unzufrieden und zog ihn wieder hoch. Niemand bemerkte, warum ich das tat. Also morgen, dachte ich.
Am nächsten Morgen betrat ich mit Herzklopfen den Hof des Gefängnisses... Wir hatten unsere Runden um den kleinen Grasflecken fast beendet in monotonem Gang — bei der vorletzten Runde sollte es geschehen. Vielleicht war ich nie so aufgeregt wie in diesen Sekunden. Noch zwanzig Schritte. Noch fünfzehn Schritte, noch zehn, fünf...
Da fing mein Vordermann plötzlich an, sonderbare Bewegungen zu machen. Dann klappte er wie eine Marionette zusammen. Die blauen Hunde bellten sofort los. Einer von ihnen trat an den Liegenden heran, stieß gegen ihn mit seinem Stiefel und sagte so selbstverständlich, wie man sagt: es regnet — so sagte er: Er ist tot.
Am andern Morgen hatte ich einen andern Vordermann. Der war wenigstens zwei Meter lang. Ich verschwand in seinem Schatten, wurde hinter ihm unsichtbar. Das war gut...
Zum Ende der halben Stunde schlug mein Herz wie rasend. Ich wechselte vor Aufregung alle paar Meter den Schritt. Merkte das denn kein Mensch? Nein. Und plötzlich bückte ich mich und fasste mit der einen Hand nach meinem heruntergerutschten Strumpf. Mit der andern Hand riss ich blitzschnell die kleine Hundeblume ab — und schon gingen wir siebenundsiebzig Gefangene in unsern Holzschuhen wieder in gewohntem Schritt in die letzte Runde.
Bald stand ich in der Gefängniszelle 432 unter dem hoch gemauerten Fenster und hielt eine kleine gelbe Blume in den schmalen Lichtstrahl — eine ganz gewöhnliche Hundeblume. Und dann hob ich die Hundeblume an meine hungrige Nase, die schon monatelang nur das Holz der Pritsche und verschiedenen Schmutz gerochen hatte. Bald bestand ich nur noch aus Nase. Die Blume füllte mich ganz aus. Ich schloss die Augen und staunte: Aber du riechst ja nach frischer Erde! Nach Sonne, Meer, Wiese! Nach Freiheit!
Ich trug sie vorsichtig zu meinem blechernen Wasserbecher, stellte das müde Blümchen hinein, und dann brauchte ich mehrere Minuten — so langsam setzte ich mich, Auge in Auge mit meiner Hundeblume.
Ich war so glücklich, dass ich alles vergaß, das mich bedrückte: die Gefangenschaft, das Alleinsein, den Hunger, die Hilflosigkeit meiner zweiundzwanzig Jahre, die Gegenwart und die Zukunft, die ganze Welt.
Die ganze Nacht hielt ich den Wasserbecher im Traum in der Hand und fühlte im Schlaf, wie die Blume nach Erde roch, nach jener Erde, auf der so viele schone Blumen wachsen.
Erläuterungen:
die Hundeblume— Löwenzahn — oдуванчик
die Zelle — камepa
das Gitter — peшeткa
kriechen (kroch, gekrochen) — зд. выползать
von selbst — caмa no ceбe
der Flecken — клочок
man bekommt es satt — это надоедает
die Sehnsucht — тocкa
den Strumpf runterrutschen lassen – дать спуститься чулку
zusammenklappen – зд. свалиться
rasend – бешено
die Pritsche – тюремная койка
riechen – нюхать, обонять
der blecherne Wasserbecher – жестяная кружка для воды
bedrücken – угнетать
die Gegenwart – настоящее
HEINRICH BÖLL
(1917 – 1985)
Heinrich Böll ist deutscher Schriftsteller und Publizist. 1972 wurde er als einziger Deutscher nach dem Krieg mit dem Nobelpreis für seine literarische Tätigkeit ausgezeichnet.
H. Böll wurde am 12.Dezember 1917 in Köln in einer bürgerlichen Familie geboren. Sein Vater war Bildhauer. Die Eltern ließen ihn den Beruf eines Buchhändlers erlernen.
Als der zweite Weltkrieg ausbrach, wurde H. Böll einberufen. Er war an der Front bis zu Ende des Weltkrieges. Er geriet in die Gefangenschaft. 1945 kehrte er nach Köln zurück.
Nach dem Krieg studierte H. Böll Linguistik und Germanistik, erprobte viele Berufe: er arbeitete als Hilfsarbeiter und dann als Angestellter. In dieser Zeit begann er zu schreiben. Er gehörte zur Schriftstellergruppe „47“, die so genannt war, weil diese Gruppe im Jahre 1947 erschien. H. Böll schrieb Novellen, Kurzgeschichten, Erzählungen.
Seine erste Erzahlungssammlung hieß „Wanderer, kommst du nach Spa...“ (1950). Seine Erzahlungen hatten zum Thema die Sinnlosigkeit des Krieges, die Leiden der einfachen Menschen, ihre Menschlichkeit in der Kriegs- und Nachkriegsjahren. Zu gleichen Zeit schrieb H. Böll eine Reihe von Romanen, die ihm verhalfen zu einem „authentischen Geschichts-Erzähler unserer Nachkriegsepoche“. Sein erster Roman war „Wo warst du, Adam?“ (1951). Dann folgten die anderen: „...Und sagte kein einziges Wort“ (1953), „Das Brot der frühen Jahre“ (1954), „Haus ohne Hüter“ (1954), „Ansichten eines Clowns“ (1963), „Gruppenbild mit Dame“ (1972).
In allen diesen Büchern sprach H. Böll über seine Erlebnisse des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre. Die Helden sind einfache Menschen, deren Leben der Krieg zerstört hat. In diesen Werken fühlen wir, dass Böll gegen den Faschismus und gegen den Militarismus war. Er kritisierte besonders die Lage in Deutschland, die Gesellschaft in Westdeutschland in seinem Roman „Billard um halb zehn“ (1959). In diesem Roman geht es um die Schicksale der deutschen Intelligenz. Eigentlich spielt die Handlung an einem Septembertag 1958. Heinrich Fämel war Architekt. Er wurde an diesem Tag 80 Jahre alt und er erinnert sich an den Anfang des Jahrhunderts und an die Faschistenjahre.
H. Böll hat auch viele Novellen und Kurzgeschichten geschrieben, zum Beispiel, „An der Brücke“. Seine erfolgreiche Novelle „Die verlorene Ehe der Katharina Blum“ (1974) ist sein Beitrag zum Problem der Bedrohung individueller Freiheit durch die Gewalt der Massenmedien und durch die Staatsüberwachung. Er schrieb auch Hörspiele und publizistische Werke. Er half den jungen deutschen Schriftstellern. Die Gruppe „47“ zeichnete ihn mit einem Preis aus: für satirische Geschichte „Das schwarze Schaf“.
H. Böll hat die Poesie des Alltags bewusst zum Thema seines Werkes gemacht, er setzte sich für Außenseiter der bundesdeutschen Gesellschaft ein, verteidigte die ewigen Werte wie Wahrheits-, Nächsten- und Friedensliebe. Er wurde oft dem Hass der bundesrepublikanischen Gesellschaft durch seine Publikationen ausgesetzt.
H. Böll starb im Jahre 1985. Am Tag der Beerdigung wehten in ganz Nordrhein-Westfalen die Trauerfahnen.
1. Lesen Sie den Text durch, stellen Sie eine Aufgliederung des Textes zusammen und erzählen Sie den Text nach.
Billard um halbzehn
( Auszug)
In diesem Auszug lernen Sie den Architektenstudenten und seine Freundin Marianne kennen.
„Wir müssen jetzt gehen“, sagte Marianne, „wir wollen sie doch nicht so lange warten lassen“.
„Lass sie ruhig warten“, sagte er. „Ich muss noch wissen, was sie mit dir gemacht haben, Lämmchen. Ich weiß ja kaum etwas von dir“.
„Lämmchen“, sagte sie, „wie kommst du darauf?“
„Es fiel mir gerade ein“, sagte er, „sag mir doch, was haben sie mit dir alles gemacht; ich muss immer lachen, wenn ich den Dodringer Akzent in deiner Stimme erkenne: er passt nicht zu dir, und ich weiß nur, dass du da zur Schule gegangen, aber nicht geboren bist, und dass du Frau Kloschgrabe beim Backen, beim Kochen und beim Bügeln hilfst“.
Sie zog seinen Kopf in ihren Schoß herunter, hielt ihm die Augen zu und sagte: „Mit mir? Was sie mit mir gemacht haben, willst du es wirklich wissen? Sie haben mit Bomben auf mich geworfen und mich nicht getroffen, obwohl die Bomben so groß waren und ich so klein; die Leute im Luftschutzkeller steckten mir Leckerbissen in den Mund; und die Bomben fielen und trafen mich nicht, ich hörte nur, wie sie explodierten und die Splitter durch die Nacht rauschten wie flaternde Vögel, und jemand sang im Luftschutzkeller „Wildgänse rauschen durch die Nacht“. Mein Vater war groß, sehr dunkel und schön, er trug eine braune Uniform mit viel Gold daran, eine Art Schwert am Gürtel, das silbern glänzte; er schoss sich eine Kugel in den Mund, und ich weiß nicht, ob du schon mal einen gesehen hast, der sich eine Kugel in den Mund geschossen hat? Nein, nicht wahr; dann danke Gott; dass dir der Anblick erspart geblieben ist. Er lag da auf dem Teppich, Blut floss über die türkischen Farben; meine Mutter aber war blond und groß und trug eine blaue Uniform, und einen hübschen schnittigen Hut trug sie, kein Schwert an der Hüfte; und ich hatte einen kleinen Bruder, er war viel kleiner als ich und blond, und der kleine Bruder hing über der Tür mit einer Schlinge um den Hals, baumelte, und ich lachte, lachte noch, als meine Mutter auch mir eine Schlinge um den Hals legte und vor sich hinmurmelte: „Er hat es befohlen“, aber da kam ein Mann herein, ohne Uniform, ohne Goldborte und ohne Schwert, er hatte nur eine Pistole in der Hand, die richtete er auf meine Mutter, riss mich aus ihrer Hand, und ich weinte, weil ich doch die Schlinge schon um den Hals hatte und das Spiel spielen wollte, das mein kleiner Bruder da oben spielen durfte, das Spiel: Er hat es befohlen, doch der Mann hielt mir den Mund zu, trug mich die Treppe hinunter, nahm mir die Schlinge vom Hals, hob mich auf einen Lastwagen...“
Joseph versuchte, ihre Hände von seinen Augen zu nehmen, aber sie hielt sie fest und fragte: „Willst du nicht weiterhören?“
„Ja“, sagte er.
„Dann musst du dir die Augen zuhalten lassen, und eine Zigarette kannst du mir geben“.
„Hier im Wald?“
„Nimm sie aus meiner Hemdtasche“,
Er spürte, wie sie seine Hemdtasche aufknöpfte, Zigaretten und Streichhölzer herausnahm, während sie mit der rechten Hand seine Augen fest zuhielt.
„Ich steck dir auch eine an“, sagte sie, „hier im Wald.- Ich war um diese Zeit genau fünf Jahre alt und so süß, dass sie mich sogar auf dem Lastwagen verwöhnten, sie steckten mir Leckerbisschen in den Mund, wuschen mich mit Seife, wenn der Wagen hielt; und man schoss mit Kanonen auf uns und mit Maschinengewehren und traf uns nicht; wir fuhren lange, ich weiß nicht genau, wie lange, doch sicher zwei Wochen, und wenn wir hielten, nahm der Mann, der das Spiel Er hat es befohlen verhindert hatte, mich zu sich, hüllte mich in eine Decke, legte mich neben sich, ins Heu, ins Stroh, und manchmal ins Bett und sagte: „Sag mal Vater zu mir“, ich konnte nicht Vater sagen, hatte zu dem Mann in der schönen Uniform immer nur Pappi gesagt, aber ich lernte es sagen: „Vater“, ich sagte es dreizehn Jahre lang zu dem Mann, der das Spiel verhindert hatte; ich bekam ein Bett, eine Decke und eine Mutter, die war streng und liebte mich, und ich wohnte in einem sauberen Haus; als ich in die Schule kam, da sagte der Pfarrer: „Sieh mal einer an, was wir da haben, da haben wir ja ein ganz unverfälschtes, waschechtes Heidenkindchen“, und die anderen Kinder, die alle keine Heidenkinder waren, lachten, und der Pfarrer sagte: „Da wollen wir aber aus unserem Heidenkind mal rasch ein Christenkindchen machen, aus unserem braven Lämmchen; und sie machten aus mir ein Christenkindchen. Und das Lämmchen war brav und glücklich, spielte Ringelreihen und Hüpfen, dann spielte es Völkerball und Seilchenspringen und liebte seine Eltern sehr; und es kam der Tag, da wurden in der Schule ein paar Tränen geweint, ein paar Reden gehalten, wurde ein paarmal was von Lebensabschnitt gesagt, und Lämmchen kam in die Lehre an einer Schneiderin, es lernte Nadel und Faden gut gebrauchen, lernte bei seiner Mutter putzen und backen und kochen, und alle Leute im Dorf sagten: „Die wird noch einmal einen Prinzen heiraten, unter einem Prinzen tut die` s nicht“ – aber es kam eines Tages ein sehr großes, sehr schwarzes Auto ins Dorf gefahren, uns ein bärtiger Mann, der das Auto steuerte, hielt auf dem Dorfplatz und fragte aus dem Auto heraus die Leute: „Bitte, können Sie mir sagen, wo hier die Schmitzens wohnen?“, und die Leute sagten: „Schmitzens gibt es hier eine ganze Menge, welche meinen Sie“, und der Mann sagte: „Die das angenommene Kind haben“, und die Leute sagten: „Ja, die, das sind die Eduard Schmitzens, die wohnen da hinten, sehen Sie da, gleich hinter der Schmiede, das Haus mit dem Buchsbaum davor“. Und der Mann sagte: „Danke“, das Auto fuhr weiter, aber alle Leute folgten ihm, denn es war vom Dorfplatz bis zu den Eduard Schmitzens höchstens fünfzig Schritte zu laufen; ich saß in der Küche und putzte Salat, das tat ich gern: die Blätter aufschneiden, das schlechte weg und das gute ins Sieb werfen, wo es so grün und sauber lag, und meine Mutter sagte gerade zu mir: „Worüber bist du denn traurig?“ Ich sagte: „Ich denke an meinen Bruder, wie er so da hing, und ich habe gelacht und gar nicht gewusst, wie schrecklich es war – und er war doch nicht getauft“. Und bevor meine Mutter mir etwas antworten konnte, ging die Tür auf – und wir hatten kein Klopfen gehört -, und ich erkannte sie sofort: Immer noch war sie blond und groß und trug einen schnittigen Hut, nur die blaue Uniform trug sie nicht mehr; sie kam sofort auf mich zu, breitete ihre Arme aus und sagte: „Du musst meine Marianne sein – spricht die Stimme des Blutes nicht zu dir?“ Ich hielt das Messer einen Augenblick still, schnitt dann das nächste Salatblatt sauber und sagte: „Nein, die Stimme des Blutes spricht nicht zu mir.“ „Ich bin deine Mutter“, sagte sie. „Nein“, sagte ich, „die da ist meine Mutter. Ich heiße Marianne Schmitz“, und ich schwieg einen Augenblick und sagte: „ Er hat es befohlen – und Sie haben mir die Schlinge um den Hals gelegt, gnädige Frau.“ Das hatte ich bei der Schneiderin gelernt, dass man zu solchen Frauen „gnädige Frau“ saugen muss.
Sie schrie und weinte, und sie versuchte mich zu umarmen, aber ich hielt das Messer, mit der Spitze nach vorne, vor meine Brust; sie sprach von Schulen und von Studieren, schrie und weinte, aber ich lief zum Hintereingang hinaus, in den Garten übers Feld zum Pfarrer und erzählte ihm alles. Er sagte: „Sie ist deine Mutter, Naturrecht ist Naturrecht, und bis du großjährig wirst, hat sie ein Recht auf dich; das ist eine schlimme Sache.“ Und ich sagte: „Hat sie nicht dieses Recht verwirkt, als sie Spiel spielte: Er hat es befohlen? “ und er sagte: „Du bist aber ein schlaues Ding; merk dir das Argument gut.“ Ich merkte es mir und brachte es immer wieder vor, wenn sie von der Stimme des Blutes sprachen, und ich sagte immer: „Ich höre die Stimme des Blutes nicht, ich höre sie einfach nicht.“ Sie sagten: „Das gibt es doch gar nicht, ein solcher Zynismus ist wider die Natur“; „Ja“, sagte ich: „ Er hat es befohlen - das war wider die Natur.“ Sie sagten: „Aber das ist doch mehr als zehn Jahre her, und sie bereut es“; und ich sagte: „Es gibt Dinge, die man nicht bereuen kann.“ „Willst du“, fragte sie mich, „härter sein als Gott in seinem Gericht?“, „Nein“, sagte ich, „ich bin nicht Gott, also kann ich nicht so milde sein wie er.“ Ich blieb bei meinen Eltern. Aber eins konnte ich nicht verhindern: ich hieß nicht mehr Marianne Schmitz, sondern Marianne Droste, und ich kam mir vor wie jemand, dem sie was wegoperiert haben. – Immer noch“, sagte sie leise, „denke ich an meinen kleinen Bruder, der das Spiel Er hat es befohlen hat spielen müssen – und glaubst du immer noch, dass es etwas Schlimmeres gibt, schlimm genug, dass du es mir nicht erzählen kannst?“
„Nein, nein“, sagte er, „Marianne Schmitz, ich will’s dir erzählen.“
Sie nahm die Hand von seinen Augen, er richtete sich auf, blickte sie an; sie versuchte nicht zu lächeln.
„So etwas Schlimmes kann dein Vater gar nicht getan haben“, sagte sie.
„Nein“, sagte er, „so schlimm war es nicht, aber schlimm genug.“
„Komm“, sagte sie, „erzähl’s mir im Auto, es ist bald fünf, und sie werden schon warten; wenn ich einen Großvater hätte, ich würde ihn nicht warten lassen, und wenn ich einen hätte wie du, ich würde alles für ihn tun.“
„Und für meinen Vater?“, fragte er.
„Ich kenne ihn noch nicht“, sagte sie, „komm. Und drück dich nicht, sag’s ihm, sobald du Gelegenheit dazu hast. Komm.“
Sie zog ihn hoch, und er legte den Arm um ihre Schulter, als sie zum Auto zurückgingen.
Erläuterungen
das Lämmchen – Verkleinerungsform zu „Lamm“; hier: unschuldiger, geduldiger Mensch
das Heidenkindchen – ungläubiges Kind, Nichtchrist
verwirken – verlieren
das Ding (umg.) – hier: Mädchen
das Ding – hier: Sache
2. Schreiben Sie 10 Fragen zum Text und gebrauchen Sie diese Fragen zum Nacherzählen dieses Textes.
...Und sagte kein einziges Wort
(Auszüge)
Unsere Rendezvous sind einem Rhythmus unterworfen, den wir noch nicht erschlossen haben. Plötzlichkeit beherrscht das Tempo, und es kommt vor, dass ich abends oft, bevor ich irgendwo unterkrieche, unser Haus aufsuche und Käte herunterrufe durch ein Klingelzeichen, das wir vereinbart haben, damit die Kinder nicht merken, dass ich in der Nähe bin. Denn das Merkwürdige ist, dass sie mich zu lieben scheinen, nach mir verlangen, von mir sprechen, obwohl ich sie schlug in den letzten Wochen, in denen ich bei ihnen war: ich schlug sie so heftig, dass ich erschrak über den Ausdruck meines Gesichts, als ich mich plötzlich mit wirren Haaren im Spiegel sah, blass und doch schweißbedeckt, wie ich mir die Ohren zuhielt, um das Geschrei des Jungen nicht zu hören, den ich geschlagen hatte, weil er sang. Einmal erwischten sie mich, Clemens und Carla, an einem Samstagnachmittag, als ich unten in der Tür auf Käte wartete. Ich erschrak, als ich bemerkte, dass ihre Gesichter plötzlich Freude zeigten über meinen Anblick. Sie stürzten auf mich zu, umarmten mich, fragten, ob ich gesund sei, und ich ging mit ihnen die Treppe hinauf. Aber schon als ich unser Zimmer betrat, fiel wieder Schrecken über mich, der furchtbare Atem der Armut — selbst das Lächeln unseres Kleinsten, der mich zu erkennen schien, und die Freude meiner Frau — nichts war stark genug, die gehässige Gereiztheit zu unterdrücken, die sofort in mir aufstieg, als die Kinder anfingen zu tanzen, zu singen. Ich verließ sie wieder, bevor meine Gereiztheit ausbrach.
Aber oft, wenn ich in den Kneipen hocke, tauchen plötzlich ihre
Gesichter zwischen Biergläsern und Flaschen vor mir auf, und ich
vergesse den Schrecken nicht, den ich empfand, als ich meine Kinder
heute morgen in der Prozessiön sah.
Ich sprang vom Bett auf, als an der Kathedrale der Schlussgesang einsetzte, öffnete das Fenster und sah, wie die rote Gestalt des Bischofs durch die Menge schritt.
Unter mir im Fenster sah ich das schwarze Haar einer Frau, deren Kleid mit Schuppen bedeckt war. Ihr Kopf schien auf der Fensterbank zu liegen. Sie drehte sich plötzlich mir zu: es war das schmale talgig glänzende Gesicht der Wirtin. „Wenn Sie essen wollen", rief sie, „wird es Zeit."
„Ja", sagte ich, „ich komme."
Als ich die Treppe hinunterging, setzte unten am Kai die Kanonado der Zahnpastenfirma wieder auf.
--------------------------
Bellermann half mir in den Mantel, ich nahm meine Tasche, küsste die Kinder und segnete sie. Ich fühlte, dass ich überflüssig war.
Draußen blieb ich einen Augenblick vor der Tür stehen, hörte sie drinnen lachen und ging langsam die Treppe hinab.
Es war erst halb vier, und die Straßen waren noch leer. Einige Kinder spielten Hüpfen. Sie blickten auf, als meine Schritte sich näherten. Nichts war zu hören in dieser Straße, die von vielen hundert Menschen bewohnt ist, als meine Schritte: aus der Tiefe der Straße kam das fade Klimpern eines Klaviers, und hinter einem Vorhang, der sich sanft bewegte, sah ich eine alte Frau mit gelblichem Gesicht, die einen fetten Köter auf den Armen hielt. Immer noch, obwohl wir schon acht Jahre dort wohnen, ergreift mich Schwindel, wenn ich aufblicke: die grauen Mauern, schmutzig ausgeflickt, scheinen sich zu neigen, und die schmale graue Straße des Himmels hinab, hinauf lief das dünne Klimpern des Klaviers, gelangen schienen mir die Töne, zerbrochen die Melodie, die ein blasser Mädchenfinger suchte und nicht fand. Ich ging schneller, rasch an den Kindern vorbei, deren Blick mir eine Drohung zu enthalten schien.
Fred sollte mich nicht allein lassen. Obwohl ich mich freue, ihn zu treffen, erschreckt mich die Tatsache, dass ich die Kinder verlassen muss, um bei ihm zu sein. Sooft ich ihn frage, wo er wohnt, weicht er mir aus, und diese Blocks, bei denen er angeblich seit einem Monat haust, sind mir unbekannt, und er verrät mir die Adresse nicht. Manchmal treffen wir uns abends schnell in einem Cafe für eine halbe Stunde, während die Hauswirtin die Kinder beaufsichtigt. Wir umarmen uns dann flüchtig an einer Straßebahnstation, und wenn ich in die Bahn steige, steht Fred dort und winkt. Es gibt Nächte, in denen ich auf unserer Couch liege und weine, während rings um mich Stille herrscht. Ich höre den Atem der Kinder, die Bewegung des Kleinen, der unruhig zu werden beginnt, weil er zahnt, und ich bete weinend, während ich höre, wie um mich herum mit dumpftem Mahlen die Zeit verrinnt. Dreiundzwanzig war ich, als wir heirateten – seitdem sind fünfzehn Jahre vergangen, dahingerollt, ohne dass ich es bemerkte, aber ich brauche nur die Gesichter meiner Kinder zu sehen, um zu wissen: jedes Jahr, das ihrem Leben hinzugefügt wird, wird meinem genommen.
3. Text fur selnstandiges Lesen
Die Stimme Wolfgang Borcherts.
Diese Auswahl ist für diejenigen bestimmt, die jetzt so alt sein mögen, wie Wolfgang Bordiert war, als er zum erstenmal im Militärgefängnis saß. Die Briefe des zwanzigjährigen Soldaten Wolfgang Borchert waren als staatsgefährend erkannt, Bordiert war zum Tode verurteilt worden, und man ließ den Verurteilten sechs Wochen lang in der Zelle warten, ehe man ihn begnadigte. Zwanzig Jahre alt sein, sechs Wochen lang in der Zelle hocken und wissen, dass man sterben soll, sterben einiger Briefe wegen, in denen man seine Meinung über Hitler und den Krieg geschrieben hatte. Die zwanzigjährigen, die dieses kleine Buch in die Hand nehmen, mögen daran erkennen, wie kostspielig die eigene Meinung sein kann, wie hoch der Preis, den man dafür ansetzen muss...
Später wurde der vierundzwanzigjährige Borchert noch einmal für neun Monate eingesperrt, einiger Witze wegen, die er erzählt hatte: die Briefe eines Zwanzigjährigen, die Witze eines Vierundzwanzigjährigen zu rächen, musste der ganze verlogene Rechtsapparat in Bewegung gesetzt werden. So empfindlich sind die totalen Staaten: sie vertragen die Nadelstiche der Freiheit nicht: ihre Antwort ist Mord. Wolfgang Borchert war achtzehn Jahre alt, als der Krieg ausbrach, vierundzwanzig, als er zu Ende war. Krieg und Kerker hatten seine Gesundheit zerstört, das übrige tat die Hungersnot der Nachkriegsjahre, er starb am 26. November 1947, sechsundzwanzig Jahre alt. Zwei Jahre blieben ihm zu schreiben, und er schrieb in diesen beiden Jahren, wie jemand im Wettlauf mit dem Tode schreibt; Wolfgang Borchert hatte keine Zeit, und er wusste es. Er zählt zu den Opfern des Krieges, es war ihm...nur eine kurze Frist gegeben, um den Überlebenden... zu sagen, was die Toten des Krieges, zu denen er gehört, nicht mehr sagen konnten: dass alle ihren glatten Worten die schlimmsten ihrer Lügen sind. Das törichte Pathos der Fahnen, dass Geknalle der Salutschüsse und der fade Heroismus der Trauermärsche – dass alles ist so gleichgültig für die Toten...Die Wahrheit des Dichters, Borcherts Wahrheit ist, dass alle Schlachten, die gewonnen und die verlorenen, Gemetzel waren, dass für die Toten die Blumen nicht mehr blühen, kein Brot mehr für sie gebacken wird, der Wind nicht mehr für sie weht; dass ihre Kinder Waisen, ihre Frauen Witwen sind und die Eltern um ihre Söhne trauern...
Im Dialog Beckmanns mit dem anonymen Obersten in „ Draußen vor der Tür“ wird Rechenschaft gefordert, Rechenschaft nur für elf, elf Väter, Söhne, Brüder, elf von vielen Millionen - aber Beckmann bekommt keine Antwort...Es ist viel von „ Aufschrei Borcherts“ geschrieben und gesagt worden, und die Bezeichnung „Aufschrei" wurde mit der Gelassenheit geprägt...Die Dichter...sind immer betroffen, und niemand nimmt ihnen die Last ab, die auch die Last des jungen Borchert war, diese Betroffenheit in einer Form auszudrücken, die wie Gelassenheit erscheinen mag... Borcherts Erzählung „Brot“ mag als Beispiel dienen: sie ist Dokument, Protokoll des Augenzeugen einer Hungersnot, zugleich aber ist sie eine meisterhafte Erzählung, kühl und knapp, kein Wort zu wenig, kein Wort zuviel — sie lässt uns ahnen, wozu Borchert fähig gewesen wäre: diese kleine Erzählung wiegt viele gescheite Kommentare über die Hungersnot der Nachkriegsjahre auf, und ist mehr noch als das: ein Musterbeispiel für die Gattung Kurzgeschichte, die nicht mit novellistischen Höhepunkten und der Erläuterung moralischer Wahrheiten erzählt, sondern erzählt, indem sie darstellt. Die „Helden“ dieser Geschichte sind recht alltäglich: ein altes Ehepaar, neununddreißig Jahre miteinander verheiratet. Und der „Streitwert“ in dieser Geschichte ist gering (und doch so gewaltig, wie ihn die Augenzeugen der Hungersnot noch in Erinnerungen haben mögen): eine Scheibe Brot. Die Erzählung ist kurz und kühl. Und doch ist das ganze Elend und die ganze Größe des Menschen mit aufgenommen...
Diese kleine Erzählung und der Dialog Beckmanns mit dem Obersten allein weisen Borchert als einen Dichter aus, der unvergesslich macht, was die Geschichte so gern vergisst: Die Reibung, die der einzelne zu ertragen hat, indem er Geschichte macht und sie erlebt. Ein Strich über Generalstabskarte, das ist ein marschierendes Regiment; eine Stecknadel mit rotem, grünem, blauem oder gelbem Kopf ist eine kämpfende Division: man beugt sich über Karten, steckt Fähnchen, Nadeln, errechtet Koordinaten... Für den einzelnen jedoch hat es nie taktische Zeichen gegeben: ein alter Mann, der sich heimlich in der Nacht eine Scheibe Brot abschneidet - seine Frau, die ihm eine Scheibe Brot schenkt. Elf Gefallene: Männer und Brüder, Söhne, Väter und Gatten - die Geschichte geht achselzuckend darüber hinweg...Ein Name in den Büchern „Stalingrad“ oder „Versorgungskrise“ - Wörter, hinter denen die einzelnen verschwinden. Sie ruhen nur im Gedächtnis des Dichters, im Gedächtnis Wolfgang Borcherts, der nicht gelassen sein konnte.
ERWIN STRITTMATTER
(1912-1994)
Erwin Strittmatter gehört zu den Schriftstellern, die nicht aus dem Proletariat aufstiegen, sondern mit dem Proletariat. Er ist der Sohn eines Landarbeiters aus der Niederlausitz, durchlief viele Berufe, war Landarbeiter, Bäcker, Pelzfarmer und so weiter, wurde nach 1945 Bürgermeister auf dem Dorf, Volkskorrespondent, Schriftsteller. „Ohne die Deutsche Demokratische Republik wäre er nicht nur der Schriftsteller geworden, der er ist, sondern vermutlich überhaupt kein Schriftsteller“. Mit diesen Worten kennzeichnete Bertolt Brecht die Entwicklung Strittmatters als eines sozialistischen Schriftstellers. Eine innige Freundschaft verband E. Strittmatter mit dem großen deutschen Dichter und Dramatiker B. Brecht. E. Strittmatter erzählt mehrere Episoden aus Brechts Leben, er schreibt über ihn oft mit Humor, immer aber mit Liebe und Verehrung.
E. Strittmatter wuchs an einem Niederlausitzer Dorf auf, besuchte bis seinem 16. Lebensjahr das Realgymnasium, danach erlernte er das Bäckerhandwerk. Die weiteren Jahre der Arbeit in verschiedenen Berufen brachten dem zukünftigen Schriftsteller gute Menschenkenntnis und weite Lebenserfahrungen.
1934 war er wegen Widersetzlichkeit gegen das faschistische Regime in Deutschland kurze Zeit verhaftet. Später wurde er Soldat der Hitlerwehrmacht und desertierte gegen Ende des Krieges. 1945 kehrte E. Strittmatter in seinen Heimatort zurück.
Früh versuchte sich E. Strittmatter als Schriftsteller. Ab 1947 war er Volkskorrespondent einer Zeitung, dann Zeitungsredakteur und letzten Endes wurde er freischaffender Schriftsteller. Bertolt Brecht bemerkte den jungen Autor und förderte ihn.
1959 wurde E. Strittmatter zum ersten Sekretär des Deutschen Schriftstellerverbandes. Später wurde der weit bekannte und viel gelesene Schriftsteller Erwin Strittmatter Vizepräsident des Schriftstellerverbandes der DDR, Mitglied der Deutschen Akademie der Künste, ein mit mehreren Nationalpreisen geehrter Autor.
Das Zentralproblem im Werk von E. Strittmatter ist die demokratische und sozialistische Umgestaltung des Lebens auf dem Lande. Sein erstes Buch, das bereits die sprachliche Gestaltungskraft des Autors zeigte, ist ein bäuerlich-proletarischer Entwicklungsroman „Der Ochsenkutscher“ (1950). Die Handlung entwickelt sich auf einem Gutshof der Niederlausitz und schildert den Lebensweg eines Dorfjungen, der in mehreren Hinsichten stark autobiographisch erscheint. Aber nicht allein das menschliche Schicksal erfasst der Roman, sondern zugleich die Klassenverhältnisse auf dem Lande in der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts bis zum Anbruch des Faschismus in Deutschland.
Acht Jahre später veröffentlichte Strittmatter die vieraktige Verskomödie „Katzgraben. Szenen aus dem Bauernleben“ (1954). Der Titel selbst erläutert das Thema. Die Komödie wurde von B. Brecht im „Berliner Ensemble
 2018-02-14
2018-02-14 782
782








